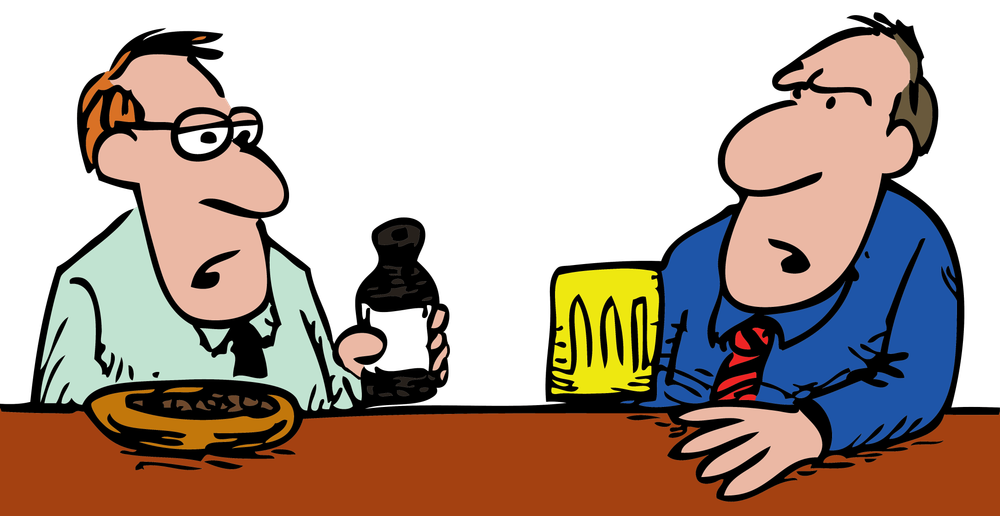Der Weg zur Berufung ist nicht in einem Zug gewonnen: Es braucht Geduld.(Adobe Stock)
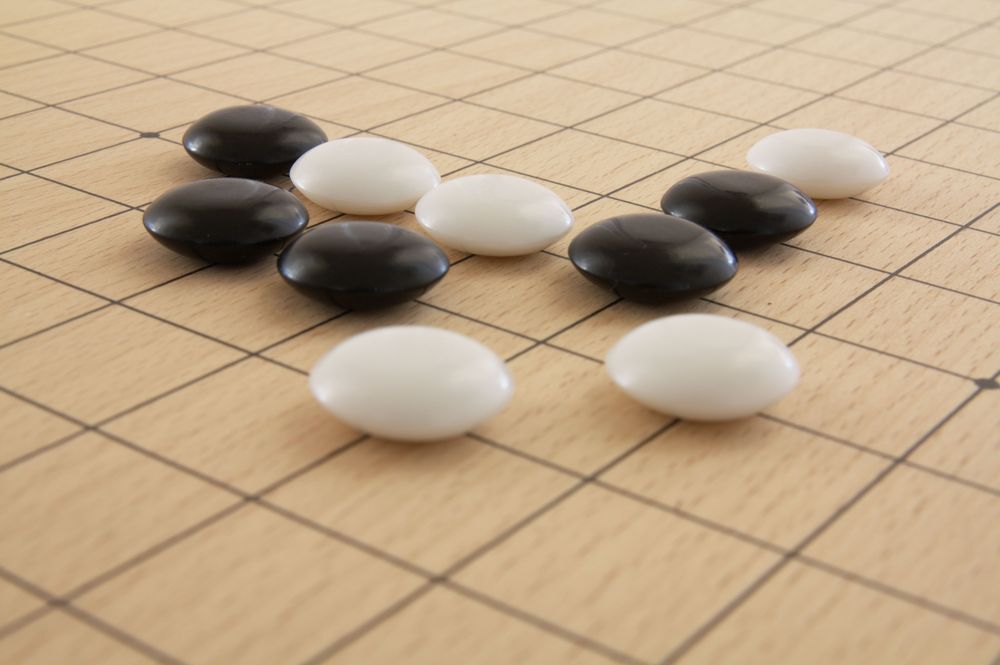
Führung
30.9.2025 | Mathias Morgenthaler
Berufung ist kein Luxusgut
Die Arbeitswelt verändert sich rasant. Statt mehr zu schuften, sollten wir lernen, unserer inneren Stimme zu folgen – und die eigene Arbeit so zu gestalten, dass sie Sinn macht.
Sind wir naiv? Während Chatbots auf der Basis von künstlicher Intelligenz Texte schreiben, Diagnosen stellen und bald auch Anwälte, Controllerinnen und Werbetexter ersetzen, diskutieren wir ernsthaft über Berufung? Täten wir nicht besser daran, härter zu arbeiten, programmieren zu lernen und weniger wählerisch bei der Berufswahl zu sein, um im globalen Wettbewerb nicht unterzugehen?
Das Gegenteil ist der Fall. Wir sollten nicht härter arbeiten, sondern smarter. Die Zukunft gehört nicht den Angepassten, sondern den Entdeckerinnen und Entdeckern. Die grösste Ressource in Zeiten exponentieller Technologie ist nicht Fleiss, sondern Kreativität. Und diese Kreativität entfaltet sich nicht, wenn wir uns pausenlos abmühen und brav Jobprofile ausfüllen. Sie entfaltet sich, wenn wir Abstand gewinnen zu den Dingen und ein Gefühl dafür entwickeln, was uns wichtig ist und was wir bewegen wollen.
Von der Fabrikhalle zum Yogastudio
Frithjof Bergmann, Sozialphilosoph und Begründer der «New Work»-Bewegung, brachte es auf die Formel: «Tun, was wir wirklich, wirklich wollen.» Das war schon Ende der 1970er Jahre kein romantisches Hobbyprojekt, sondern eine Überlebensstrategie. Damals drohte in der US-amerikanischen Automobilindustrie wegen der ersten Automatisierungswelle eine Massenentlassung.
Bergmann schlug den Managern von General Motors in Flint vor, nicht die Hälfte der Leute auf die Strasse zu stellen, sondern die Mitarbeiter nur noch die Hälfte des Jahres bezahlt am Fliessband arbeiten zu lassen und ihnen die andere Hälfte Zeit zugeben, sich mit etwas Interessanterem zu beschäftigen: mit der Frage, was sie wirklich tun wollten. So entstanden – aus der Not geboren – persönliche Lebensentwürfe und stimmige Tätigkeiten. Fabrikarbeiter wurden zu Yogalehrern, Schriftstellern, Gastronomen.
Nicht die Angst zu scheitern sollte uns als Kompass dienen, sondern die Freude am Lernen und Gestalten.
Heute gibt es weniger Fliessbandjobs, aber nach wie vor viele Menschen, die sich ohne Herzblut bei ihrer Arbeit abmühen. Wer den grössten Teil seiner Lebenszeit mit einer Tätigkeit verbringt, zu der er keinen inneren Bezug hat, läuft Gefahr, sich selbst zu verlieren – und bald auch seinen Job. Denn austauschbare Routinearbeit wird von Algorithmen übernommen. Was weiterhin eine Daseinsberechtigung hat, sind Tätigkeiten mit einer persönlichen Handschrift, Arbeit, die Sinn stiftet und Beziehungen gestaltet, die Neues hervorbringt.
Es wäre fatal, die Suche nach der Berufung als Luxusproblem Privilegierter abzutun. Denn die Kosten, die unmotivierte Mitarbeitende erzeugen, sind enorm: Laut Gallup leisten in der Schweiz 81 Prozent der Angestellten nur Dienst nach Vorschrift, weitere zehn Prozent haben innerlich gekündigt. Chronischer Stress verursacht allein in der Schweiz Milliardenkosten. Und wer auf dem Sterbebett bereut, die eigenen Träume nie ernst genommen zu haben, zahlt den höchsten Preis von allen.
Doch wie kommt man ihr auf die Spur, der eigenen Berufung?
Hans Rusinek, der an der Universität St. Gallen zum Wandel der Arbeitswelt forscht, bringt es wie folgt auf den Punkt: «Wo deine Talente auf die Bedürfnisse der Welt treffen, liegt deine Berufung.» Damit sagt er auch: Die Suche nach Berufung ist kein esoterischer Egotrip. Sie verlangt nicht nur Selbsterkenntnis – sondern auch Offenheit und Dialog.
Wer mehr Sinn und Erfüllung sucht, muss sich nicht zurückziehen und/oder selbstständig machen, sondern manchmal ist der lohnendste Weg, den bisherigen Job so umzugestalten, dass er mehr Freude macht, mehr die eigene Handschrift bekommt (Job-Crafting); statt zu kündigen also mit dem Arbeitgeber Freiräume auszuhandeln.
Die Schule der Anpassung verlassen
So unterschiedlich die Wege sind, die zur eigenen Berufung führen, eine Sache ist unerlässlich: die eigene innere Stimme ernster zu nehmen als die Erwartungen anderer. Das ist oft schwieriger, als es klingt. Wir lernen früh, uns anzupassen. Wir werden als Kinder für das richtige Verhalten gelobt, für Ungehorsam getadelt, später fürs Bravsein befördert. Wir werden Spezialisten darin, Erwartungen zu erfüllen. Und wundern uns, wenn sich keine Erfüllung einstellt.
Die Anpassungskarriere ist bequem, aber teuer: Sie kostet Lebendigkeit, Kreativität – und am Ende die Freude an der Arbeit. Sich zu entwickeln heisse, sich aus den Erwartungen anderer herauszuwickeln und Eigenes zu wagen, hat der Neurobiologe Gerald Hüther treffend festgestellt. Wer sich seiner Berufung nähern will, kommt nicht darum herum, Menschen zu enttäuschen und sich mit Unsicherheit anzufreunden.
Keine Prüfung, sondern eine Expedition
Deshalb plädiere ich für ein Bildungs- und Arbeitsmodell, das die Entdeckerqualitäten des Menschen ins Zentrum rückt statt den Fleiss.
Bildung als Entdeckungsreise: Weg vom kollektiven kurzfristigen Auswendiglernen für Prüfungen, hin zu individueller Neugier. Kinder brauchen weniger standardisierte Lernziele, sondern die Gelegenheit herauszufinden, was sie wirklich interessiert.
Organisationen als Möglichkeitsräume: Es braucht in Unternehmen weniger starre Jobprofile und mehr Rollen, die sich verändern dürfen; mehr Arbeit, die in Projekten organisiert ist statt in Abteilungen; Organisationen sollten Mitarbeitende mehr an ihren Werten und ihrem Potenzial messen statt an ihrem CV und der Anzahl Dienstjahre.
Wachstum beginnt im Kopf: Nicht die Angst zu scheitern sollte uns als Kompass dienen, sondern die Freude am Lernen und Gestalten. Das Leben ist keine Prüfung, sondern eine Entdeckungsreise. Was wir heute können und wissen, ist weniger entscheidend, als dass wir motiviert sind, Neues zu lernen.
Diese Offenheit sollten wir auch in Bezug auf unsere Berufung bewahren. Berufung ist kein heiliger Gral, den wir eines Tages finden. Das Wort steht für einen Suchprozess, der nie ganz abgeschlossen ist, der uns aber mit Sicherheit näher zu uns führt und gleichzeitig unseren Empathiemuskel stärkt.
Wenn mehr Menschen ihre Berufung leben, profitieren nicht nur sie selbst. Studien zeigen: Wer seine Arbeit als sinnvoll erlebt, ist gesünder, engagierter, kooperativer. Das färbt ab – auf Teams, auf Unternehmen, auf die Gesellschaft. Die Folgen wären: weniger Zynismus, weniger Aggression, weniger Flucht in Ersatzbefriedigungen; stattdessen mehr Achtsamkeit, mehr Gemeinschaft und mehr Nachhaltigkeit.
Seine Berufung zu leben ist also keineswegs egoistisch; es bedeutet vielmehr, das eigene Leben ernst zu nehmen und einen Beitrag zu leisten, der über das reine Funktionieren hinausgeht. Das ist eine Notwendigkeit in einer Welt, in der Menschen ihre Einzigartigkeit neu definieren müssen.
Wer glaubt, er könne in disruptiven Zeiten überleben, indem er noch härter arbeitet, irrt. Wir müssen nicht schneller im Hamsterrad laufen – wir müssen aussteigen. Und anfangen, das zu tun, was wir wirklich, wirklich wollen und was die Welt ein klein wenig besser macht.