(Illustration: Armin Apadana)
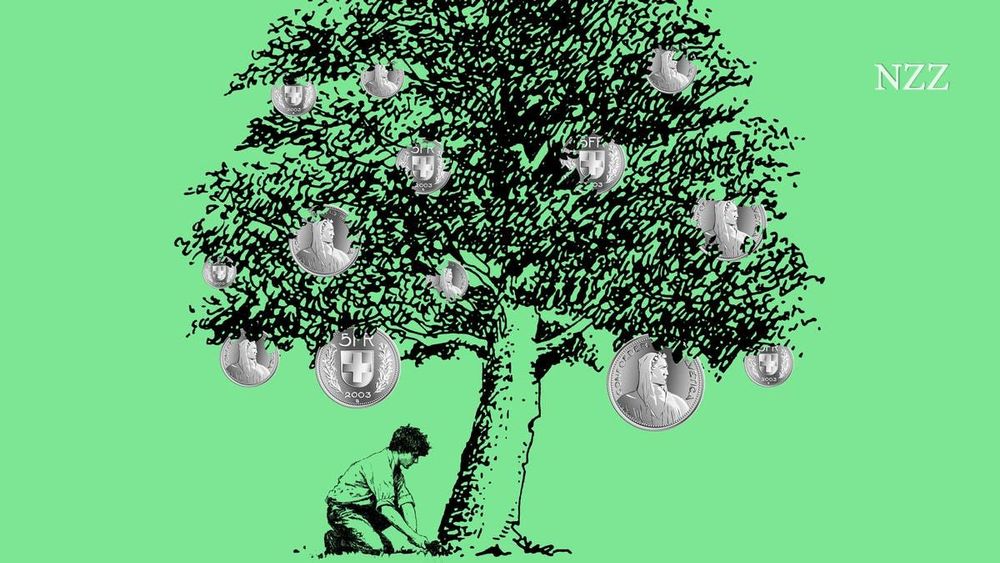
Versicherung
3.6.2025 | nzz.ch
Sponsored Content
Mit Herzblut für die zweite Säule
Das BVG-Obligatorium baut darauf, dass sowohl Chancen als auch Risiken im Kollektiv getragen werden – es ist, wie kaum ein anderer Baustein der Altersvorsorge, auf das Denken in Dekaden ausgerichtet. Eine Einordnung von Lukas Müller-Brunner.
Dieser Inhalt ist im Rahmen der NZZ-Verlagsbeilage «40 Jahre BVG» erschienen – realisiert durch NZZ Content Creation in Kooperation mit dem Pensionskassenverband ASIP. Hier geht es zu den NZZ-Richtlinien für Native Advertising.
Das Erreichen eines runden Jubiläums ist an sich noch keine besonders erwähnenswerte Leistung. Eine Gratulation gestaltet sich zudem schwierig, wenn es sich beim «Geburtstagskind» nicht um einen Menschen, sondern um eine Säule der Altersvorsorge handelt. Dennoch ist das Inkrafttreten des Bundesgesetzes über die berufliche Vorsorge (BVG) per 1. Januar 1985, also vor 40 Jahren, ein Meilenstein der Schweizer Sozialpolitik. Das hängt mit der Mechanik des BVG zusammen: Gemäss Gesetz sparen die Erwerbstätigen zwischen 25 und 65 Jahren so viel Geld an, dass sie anschliessend den Ruhestand ohne wirtschaftliche Not geniessen können. Erst heute können wir also die Früchte dieser Geduldsprobe vollständig ernten, indem alle Versicherten, die in die zweite Säule eintreten, eine 40-jährige Beitragskarriere aufweisen können.
Die zweite Säule ist damit, wie kaum ein anderer Baustein der Altersvorsorge, auf das Denken in Dekaden ausgerichtet. Episodisch auftretende heftige Verwerfungen an den Finanzmärkten wie die Ölkrise, die Dotcom-Blase, die Finanzkrise von 2008 oder der Beginn des Krieges in der Ukraine hinterlassen zwar bei einer Betrachtung über 40 Jahre punktuelle Abstürze in einer Börsenkursgrafik. Im selben Zeitraum ist der Kapitalstock in der beruflichen Vorsorge hingegen unaufhaltsam weitergewachsen. Über den Daumen gepeilt, stammt von drei Franken Vorsorgekapital, die in der zweiten Säule heute angespart sind, rund ein Franken von Anlageerträgen, etwa ein Franken von den Arbeitnehmern und ein weiterer Franken von den Arbeitgebern. Bezahle 1, erhalte 3 – ein derartiges Preis-Leistungs-Verhältnis ist kaum zu übertreffen.
Bezahle 1, erhalte 3: Ein derartiges Preis-Leistungs- Verhältnis ist kaum zu übertreffen.
Möglich wird dieses einträgliche Alterssparen durch die Finanzierung im Kapitaldeckungsverfahren. Dank dieser Art der Vermögensbildung trägt die zweite Säule massgeblich zur finanziellen Sicherheit und dem breiten Wohlstand der Schweizer Bevölkerung bei. Demgegenüber sichert die erste Säule, die AHV, den finanziellen Grundbedarf der Pensionierten. Sie weist durch die Finanzierung im Umlageverfahren ebenfalls einen entscheidenden Vorteil auf: Anpassungen sind deutlich rascher möglich und sehr beliebt, wie der historische Entscheid des Souveräns zur Einführung einer 13. AHV-Monatsrente vor einem Jahr illustriert.
Das Drei-Säulen-System
Im Vergleich zum Ausland – namentlich zu unseren Nachbarländern Italien, Frankreich und Deutschland – hat die Schweiz nicht nur auf dem Papier ein ausgeklügeltes Drei-Säulen-System. Tatsächlich bezieht hierzulande ein Grossteil der Haushalte bei der Pensionierung Leistungen aus allen Säulen. Diese Ausgewogenheit gründet auf den drei Pfeilern, Ökonomen nennen es Diversifizierung. Während Börsenturbulenzen in der zweiten Säule zu Nervosität führen, bringen sie die Verantwortlichen der AHV nicht aus der Ruhe. Dagegen raubt ihnen die alternde Bevölkerung den Schlaf, was wiederum in der zweiten Säule aufgrund der individuellen Kapitaldeckung weniger für Kopfzerbrechen sorgt.
Trotz Lob aus dem Ausland gerät gerade die leistungsfähige zweite Säule im Inland zunehmend unter Druck. Zum einen wird ihr zuweilen nachgesagt, kompliziert und undurchsichtig zu sein. Dabei ist das Grundprinzip einfach: Arbeitnehmer und Arbeitgeber leisten gemeinsam Lohnbeiträge und sparen für eine Rente oder einen Kapitalbezug im Alter. Insofern kann die erwartete Leistung in einem BVG-Vorsorgeplan transparent mit jedem einfachen Taschenrechner ermittelt werden. Zum anderen macht die fortschreitende Individualisierung auch vor der beruflichen Vorsorge nicht halt. Von wählbaren Sparbeiträgen über Rentenmodelle bis hin zu Kapitalrückgewähr: Der Phantasie sind kaum Grenzen gesetzt. Diese Komplexitäten verleiten Finanz-Influencer auf Social Media zuweilen zu vollmundigen Empfehlungen, die Altersvorsorge doch gleich selbst in die Hand zu nehmen, um vermeintlich nicht die Kontrolle zu verlieren.
Eine Sozialversicherung
Dabei geht vergessen: Die zweite Säule ist eine Sozialversicherung. Sie baut darauf, dass sowohl Chancen als auch Risiken im Kollektiv getragen werden. Mit dieser Solidarität grenzt sie sich entscheidend von der dritten Säule, der privaten Vorsorge, ab. Aus ökonomischer Sicht ist das kollektive Tragen von Wagnissen der individuellen Herangehensweise praktisch immer überlegen. Wenn privaten Anlegern hochfliegende Renditen versprochen werden, gehen Gefahren denn auch häufig vergessen. Bei der individuellen Kapitalanlage trägt man alle Börsenschwankungen, jeden Anstieg der Lebenserwartung und auch die oftmals höheren Verwaltungskosten selbst. Bei einer Pensionskasse hingegen können alle Risiken auf eine grosse Zahl von Versicherten verteilt werden, was ökonomisch und gesellschaftlich überaus effizient ist.
40 Jahre nach Einführung des BVG-Obligatoriums lässt sich mit einer Prise Stolz bilanzieren: Getragen von den Sozialpartnern und durchgeführt von verantwortungsvollen Menschen mit Herzblut, ist mit der beruflichen Vorsorge ein Kunstwerk Schweizer Sozialpolitik entstanden, das Hochachtung geniesst und Vertrauen für die kommenden Jahrzehnte verdient.
Lukas Müller-Brunner ist Direktor des Schweizerischen Pensionskassenverbands ASIP mit Sitz in Zürich.
Branchenverband ASIP
Der Schweizerische Pensionskassenverband ASIP mit Sitz in Zürich ist der Dachverband für mehr als 900 Pensionskassen. Er vertritt über die Mitglieder rund zwei Drittel der Versicherten in der beruflichen Vorsorge sowie ein Vorsorgevermögen von gegen 650 Milliarden Franken. Der ASIP bezweckt die Erhaltung und Förderung der sozialpartnerschaftlich geführten beruflichen Vorsorge auf freiheitlicher und dezentraler Basis und setzt sich für das Drei-Säulen-Konzept in ausgewogener Gewichtung ein. Er positioniert sich als Ansprechpartner für alle Akteure im Umfeld der beruflichen Vorsorge. Die Exponenten des Verbandes vertreten die Interessen der Pensionskassen in verschiedenen Gremien sowie gegenüber der Politik und der Öffentlichkeit.

Exklusiver Inhalt aus den Medien der NZZ. Entdecken Sie die Abonnemente für die «Neue Zürcher Zeitung» hier.


