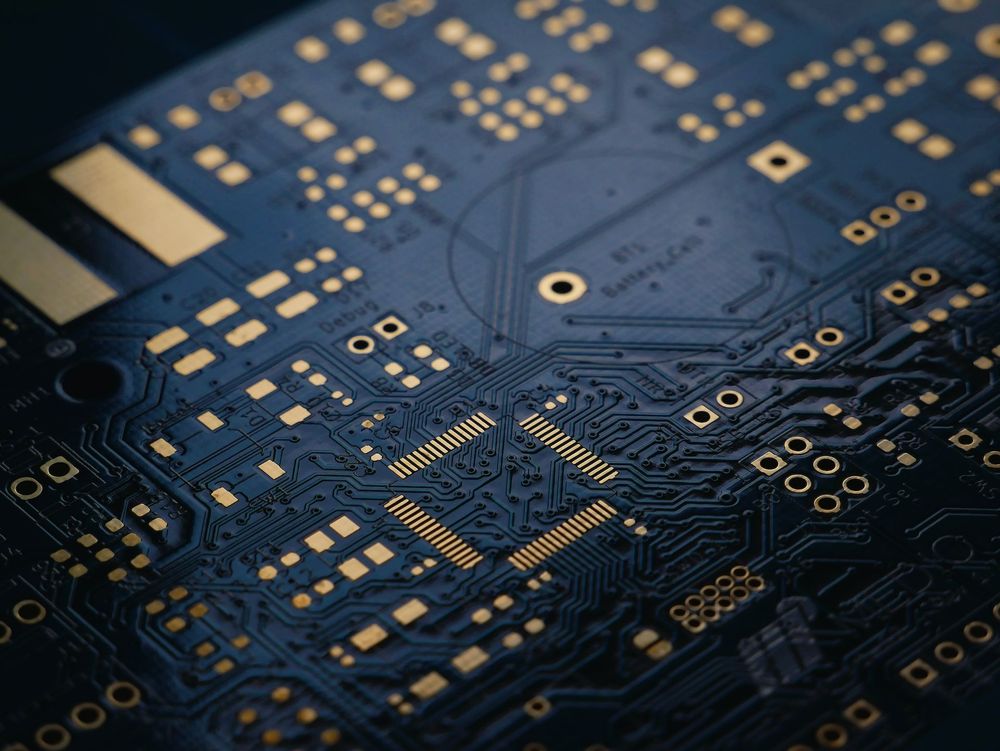Dank KI sollen in Zukunft keine Gegenstände wie Tupfer oder kleine Instrumente im Körper der Patienten vergessen werden. (Adobe Stock)

Technologie
3.9.2025 | nzz.ch
Vom Acker bis zum Operationstisch: Wie ein Zürcher Startup künstliche Intelligenz klüger macht
Täglich werden Milliarden Bilder gespeichert. Doch nur ein Bruchteil davon eignet sich für das Training von KI-Systemen. Das Zürcher Startup Lightly findet die richtigen Bilder. Damit macht es chirurgische Eingriffe sicherer oder senkt den Pestizideinsatz.
Es ist ein Fehler, der nie passieren dürfte – und doch immer wieder vorkommt: Nach chirurgischen Eingriffen lassen Ärzte Utensilien wie Tupfer, Nadeln oder kleine Instrumente im Körper der Patientinnen und Patienten zurück. In den USA werden jedes Jahr Tausende solcher Fälle gemeldet.
Die Folgen sind gravierend: Sie reichen von Infektionen über chronische Schmerzen bis hin zu lebensbedrohlichen Komplikationen. Oft ist eine erneute Operation nötig, um vergessene Gegenstände zu entfernen.
Das Zürcher Startup Lightly, ein Spin-off der ETH Zürich, arbeitet an einer Methode, um das zu verhindern. Dafür werden in Kooperation mit einer Forschungseinrichtung der ETH Zürich und der EPFL Lausanne Videoaufzeichnungen von Operationen analysiert. Das Ziel: Ein KI-Modell zu trainieren, das automatisch erkennt, ob nach einem Eingriff alle Instrumente wieder vollständig auf dem OP-Tisch liegen – und das Alarm schlägt, wenn etwas fehlt.
Die richtigen Bilder herausfiltern
Doch die Umsetzung ist anspruchsvoll: Die Videos enthalten Millionen von Einzelbildern, von denen nur ein Bruchteil für das Training der KI wirklich relevant ist. Hier kommt die Software von Lightly ins Spiel. Sie filtert aus der Bilderflut gezielt jene Frames heraus, die für das maschinelle Lernen besonders aussagekräftig sind – etwa Momente, in denen Instrumente abgelegt oder entnommen werden.
Erst durch diese gezielte Auswahl lernt das KI-Modell, zuverlässig zu erkennen, welche Werkzeuge wann verwendet wurden – und ob sie am Ende der Operation wieder vollständig vorhanden sind.
Das ist nicht das einzige Projekt von Lightly. Seit seiner Gründung vor sechs Jahren hat das Jungunternehmen mit einer beeindruckenden Reihe unterschiedlicher Firmen zusammengearbeitet – darunter der Autozulieferer Bosch, aber auch der amerikanische Tech-Gigant Google.
Seine Büros finden sich an bester Lage an der Bahnhofstrasse, direkt gegenüber dem Warenhaus Globus. Das Unternehmen arbeitet heute profitabel, aber in den Büroräumen sieht es noch immer aus wie in einem typischen Startup: Das Mobiliar ist zusammengewürfelt, als Sofas dienen dicke Polsterkissen, die auf Holzpaletten liegen. Der Co-Gründer Matthias Heller bietet dem Besucher sofort das Du an, einen Rahm zum Kaffee gibt es dann aber nicht – irgendwie hat im ganzen Stress niemand daran gedacht, welchen einzukaufen.
Spezialisierte Anwendungen
Lightly steht für eine neue Generation europäischer KI-Startups. Diese Jungunternehmen versuchen nicht, Open AI und andere Tech-Giganten zu konkurrenzieren, die immer neue, immer grössere und dadurch milliardenteure Sprachmodelle entwickeln. Sondern sie setzen auf spezifische Anwendungen. Zum Beispiel auf spezialisierte Werkzeuge, die künstliche Intelligenz für ein breites Feld von Firmen nutzbar machen.
Das Zürcher Startup kümmert sich dabei um ein zentrales Problem: die Auswahl der richtigen Daten für das Training von KI-Systemen. Denn moderne Anwendungen brauchen nicht einfach nur viele Daten – sie brauchen vor allem die richtigen.
Hier setzt die Software von Lightly an. Seine 30 Mitarbeiter helfen Unternehmen, aus riesigen Mengen an Bild- und Videomaterial gezielt jene Ausschnitte herauszufiltern, die für das Training und die Weiterentwicklung von KI-Anwendungen besonders wertvoll sind.
Zu den ersten Kunden von Lightly gehört die Automarke Audi. Die Software half dem deutschen Hersteller, die Fahrassistenzsysteme seiner Autos zu verbessern. Dafür sammelten speziell ausgerüstete Fahrzeuge Bilder aus dem Strassenverkehr – etwa an Kreuzungen, bei schlechten Wetterbedingungen oder in komplexen Verkehrssituationen.
Lightly half, die Datenflut bereits bei der Erfassung zu strukturieren. Die Software kann direkt in die Fahrzeuge integriert werden, welche die Daten sammeln. Sie analysiert in Echtzeit, ob eine Szene potenziell relevant ist – etwa, weil sie seltene Verkehrssituationen oder sicherheitskritische Momente zeigt. Nur diese Daten werden gespeichert oder übertragen.
In einem weiteren Schritt filtert Lightly die gesammelten Daten weiter. Die Software erkennt, welche Bilder neue Informationen enthalten und welche bereits durch andere Beispiele abgedeckt sind. So entsteht ein kuratierter Datensatz, der möglichst vielfältig und repräsentativ ist – ohne unnötige Wiederholungen.
Beim amerikanischen Landmaschinenhersteller John Deere kommt die Schweizer Software auf einem Traktor zum Einsatz. Ein mit Kameras ausgerüsteter Sprüharm hat dank KI und der Lightly-Software gelernt, Unkraut zu erkennen. Er spritzt Pestizide nur dort, wo sie nötig sind. Das Ergebnis: Der Pestizideinsatz konnte um bis zu 78 Prozent reduziert werden. Die Pflanzen wachsen gesünder, die Erträge steigen – und die KI wird mit jedem Einsatz besser.
Der Mensch als Lösung
Bisher hat die KI-Industrie das Problem der Analyse riesiger Datenberge auf eine erstaunlich simple Weise gelöst: mit Menschen. Unternehmen unterhalten ganze Abteilungen, in denen Angestellte den lieben langen Tag vor Bildschirmen sitzen und Informationen beschriften. Geht es etwa darum, ein Fahrassistenzsystem zu entwickeln, müssen sie bei Abertausenden von Bildern genau markieren, was ein Auto, ein Velo oder ein Fussgänger ist.
Manche Unternehmen lagern diese Arbeit auch an Dienstleister aus, die dann Menschen in Ländern wie Kenya, Venezuela oder den Philippinen an der Aufgabe arbeiten lassen – oft zu Tiefstlöhnen. Hier geht Lightly einen anderen Weg. Weil die Software die Bilder auswählt, können Unternehmen darauf verzichten, dafür eigene Teams aufzubauen.
Vielen Unternehmen eröffnet das überhaupt erst den Zugang zur Nutzung von künstlicher Intelligenz. Doch schon bald dürfte die automatisierte Auswertung für alle Firmen zur Notwendigkeit werden. Weltweit werden jedes Jahr Milliarden neuer Sensoren und Kameras verbaut – in Autos, Smartphones, Fabriken oder ganzen Städten. Die Folge ist eine Datenflut, die für Menschen irgendwann nicht mehr zu bewältigen sein wird.
Und so wird es neue Maschinen brauchen, um überhaupt noch mit den Daten fertigzuwerden, die andere Maschinen erzeugen.
Gemeinsam snowboarden
Die Geschichte von Lightly beginnt im Student Project House der ETH Zürich, einem Ort, an dem Studierende an Projekten tüfteln, Prototypen bauen und Ideen wälzen. Die Einrichtung gilt als eigentliche Startup-Brutstätte. Dort trifft Matthias Heller, der nach seiner Erwachsenenmatur und einem Wirtschaftsstudium unter anderem als Unternehmensberater gearbeitet hatte, auf den ETH-Forscher Igor Susmelj.
Susmelj, der auf einem Reithof aufwächst, zieht es schon früh zum Computer statt zur Stallarbeit. Er forscht am Computer Vision Lab der ETH Zürich, wo er sich mit der Frage beschäftigt, wie Maschinen lernen, Bilder zu verstehen. Den beiden wird zwar schnell klar, dass sie gemeinsam ein Startup gründen wollen. Auf eine konkrete Geschäftsidee kommen sie aber erst nach mehreren gemeinsamen Snowboardtouren. 2019 gründeten sie Lightly.
Ihr Unternehmen will heute aber nicht nur dabei helfen, die wichtigen Daten zu finden – sondern auch, die unwichtigen wieder loszuwerden. «Bei unseren Kunden verdoppelt sich die Datenmenge jedes Jahr», sagt der Mitgründer Matthias Heller. Die Software von Lightly kann darum analysieren, welche Bilder oder Videos für das Training eines KI-Modells keinen Mehrwert mehr bieten – und sie zur Löschung markieren.
Doch das Löschen fällt vielen Firmen schwer: «Wir Menschen haben Angst, etwas Wichtiges zu verlieren», sagt Heller. Dabei ist oft das Gegenteil der Fall, wie er sagt: Wer nicht löscht, verliert den Überblick – und handelt sich stetig steigende Kosten für Speicherung und Datenverwaltung ein.
Bei KI-Daten sei es darum ähnlich wie bei den Fotos, die wir alle auf unseren Handys speicherten, sagt Heller zum Abschied. «Am Ende ist nicht entscheidend, wie viele Bilder man hat – sondern ob die richtigen dabei sind.»

Exklusiver Inhalt aus den Medien der NZZ. Entdecken Sie die Abonnemente für die «Neue Zürcher Zeitung» hier.