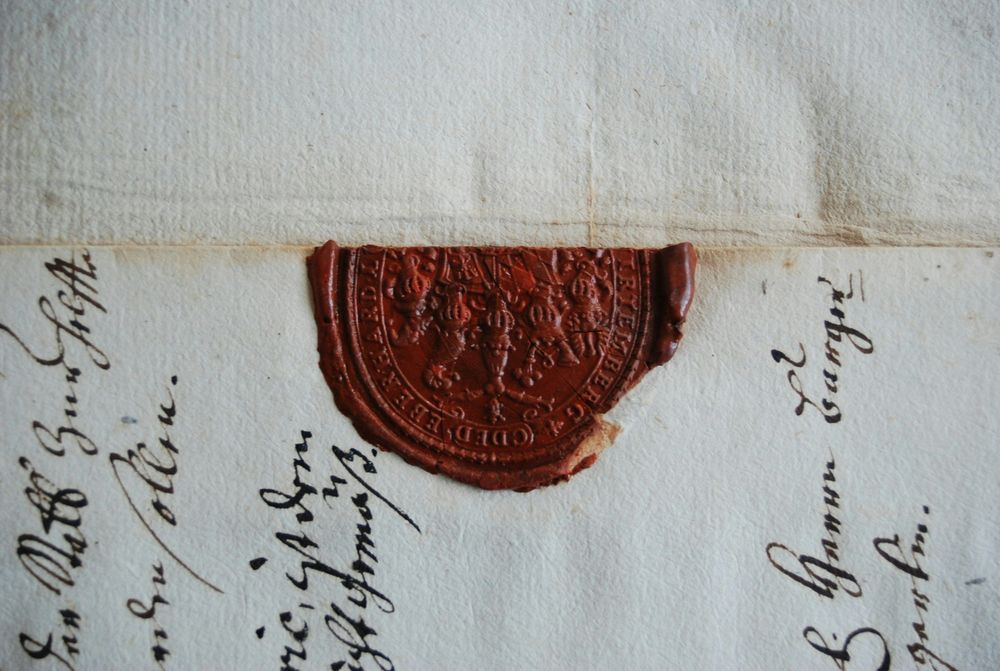Ein Haus, zwei Meinungen: Immobilienaufteilung bei einer Scheidung erfordert Fingerspitzengefühl. (Adobe Stock)

Recht
8.9.2025 | Sponsored Content
Sponsored Content
Was passiert bei einer Scheidung mit dem gemeinsamen Wohneigentum?
Scheidung und Immobilie: Wer bekommt das Haus? Eine Trennung hat nicht nur emotionale, sondern auch steuerliche und rechtliche Folgen – insbesondere bei Immobilien.
Dieser Inhalt wurde von NZZ Content Creation im Auftrag von Banque Bonhôte erstellt. Der Auftraggeber trägt die redaktionelle Verantwortung für diesen Beitrag. Hier geht es zu den NZZ-Richtlinien für Native Advertising.
In der Schweiz werden nahezu 40 Prozent aller Ehen geschieden. Die finanziellen Folgen sind in vielen Fällen erheblich – insbesondere dann, wenn Immobilien im Spiel sind. Zum Zeitpunkt der Scheidung wird das gemeinsame Vermögen der Ehegatten gemäss den Regeln ihres Güterstands aufgeteilt, was häufig eine Änderung der Eigentumsverhältnisse an der Immobilie mit sich bringt.
Nehmen wir das Beispiel eines Paars, das im Jahr 2000 unter dem ordentlichen Güterstand der Errungenschaftsbeteiligung heiratet. Im Jahr 2010 erwerben die Ehegatten zu gleichen Teilen für eine Million Franken eine Immobilie im Miteigentum, finanziert mit Errungenschaftsvermögen. Zum Zeitpunkt der Scheidung im Jahr 2020 wird die Immobilie auf zwei Millionen Franken geschätzt (von beiden Ehegatten anerkannter Verkehrswert).
Verkauf an Dritte
Als erste Möglichkeit bietet sich der Verkauf an einen Dritten an. Diese Lösung wird häufig gewählt, wenn keiner der Ehegatten die Kosten für die Immobilie (Hypothekarschuld, Unterhalt usw.) allein tragen kann. In diesem Fall wird der Verkaufserlös entsprechend dem Eigentumsanteil und der ursprünglichen Investition unter den Ehegatten aufgeteilt. In unserem Beispiel erhalten beide Partner je eine Million Franken.
Zudem müssen beide die anfallende Grundstückgewinnsteuer umgehend entrichten oder ihren Gewinn in einen neuen Hauptwohnsitz reinvestieren, um die Besteuerung aufzuschieben.
Übernahme durch einen Ehegatten
Eine zweite Möglichkeit besteht darin, dass einer der Ehegatten die Immobilie ins Alleineigentum übernimmt. In diesem Fall muss dieser den anderen entschädigen. Die Ausgleichszahlung beträgt in unserem Beispiel 500’000 Franken, was der Hälfte des Wertzuwachses der Immobilie entspricht, da der Kauf aus Errungenschaftsvermögen finanziert wurde. Die Entschädigung kann durch Verrechnung mit anderen Vermögenswerten im Rahmen der Auflösung des Güterstands erfolgen. Die Eigentumsübertragung findet am Tag der Scheidung statt.
Im Rahmen dieser Auflösung kann die Besteuerung des Grundstückgewinns beim übertragenden Ehegatten aufgeschoben werden – vorausgesetzt, beide Ehegatten sind damit einverstanden. Ist dies nicht der Fall, wird durch die Übertragung des Miteigentumsanteils die Besteuerung des Grundstückgewinns sofort ausgelöst.
Vorteil des Steueraufschubs
Ein Aufschub bietet mehrere Vorteile: Für den Ehegatten, der seinen Anteil abgibt, entsteht kein Liquiditätsbedarf zur Zahlung der Steuer. Und für den Ehegatten, der die Immobilie übernimmt, wird der bei einem späteren Verkauf realisierte Grundstückgewinn zu einem tieferen Satz besteuert, da ein degressiver Steuertarif nach Besitzdauer zur Anwendung kommt.
Auch eine Handänderungssteuer kann anfallen – in vielen Kantonen jedoch reduziert oder erlassen.
Kommt es zu einer Eigentumsübertragung zwischen den Ehegatten, kann für den übernehmenden Ehegatten eine Handänderungssteuer anfallen. In den meisten Kantonen wird diese jedoch erlassen oder ein reduzierter Satz angewendet, sofern die Übertragung im Rahmen der güterrechtlichen Auseinandersetzung erfolgt.
Nutzung der Immobilie
Es ist ebenfalls möglich, dass keine Eigentumsübertragung erfolgt und einer der Ehegatten – häufig zusammen mit den Kindern – die Immobilie weiterhin bewohnt.
Diese Überlassung der Nutzung, vorzugsweise durch die Begründung eines Nutzniessungs- oder Wohnrechts, gilt als Unterhaltsleistung in natura und muss in die vom Gericht genehmigte Scheidungsvereinbarung aufgenommen werden. Der Nutzungswert entspricht in der Regel dem Eigenmietwert. Dabei sind jedoch verschiedene steuerliche Aspekte zu berücksichtigen.
Steuerliche Auswirkungen
- Bezüger: Müssen Unterhaltsleistungen versteuern
- Leistender: Kann sie steuerlich abziehen
- Wichtig: Ab Volljährigkeit der Kinder sind deren Leistungen nicht mehr abzugsfähig
Auf Unterhaltsleistungen fallen beim Ex-Ehegatten sowie bei den minderjährigen Kindern, denen diese zugutekommen, Steuern an. Auf der anderen Seite sind sie beim Leistenden (Eigentümer) steuerlich abzugsfähig. Dabei ist wichtig, dass die Nutzungsanteile des Ex-Ehegatten und der Kinder genau festgelegt werden. Denn ab der Volljährigkeit der Kinder sind die entsprechenden Leistungen nicht mehr abzugsfähig.
Darüber hinaus sollte die finanzielle Verantwortung für Unterhaltskosten der Immobilie sowie für Hypothekarschuld und Zinsen ebenfalls in der Unterhaltsvereinbarung geregelt werden. Die Möglichkeit steuerlicher Abzüge ist basierend auf dem gewährten Nutzungsrecht zu prüfen.
Der Verkauf oder die Übertragung einer Immobilie im Rahmen einer Scheidung bringt zahlreiche – insbesondere steuerliche – Auswirkungen mit sich. Da jede Situation individuell ist, wird empfohlen, einen Spezialisten beizuziehen, um die passende Lösung für Ihre spezifische Lage zu finden.

Dieser Inhalt wurde von NZZ Content Creation im Auftrag eines Kunden erstellt. Der Auftraggeber trägt die redaktionelle Verantwortung. Hier geht es zu den NZZ-Richtlinien für Native Advertising.