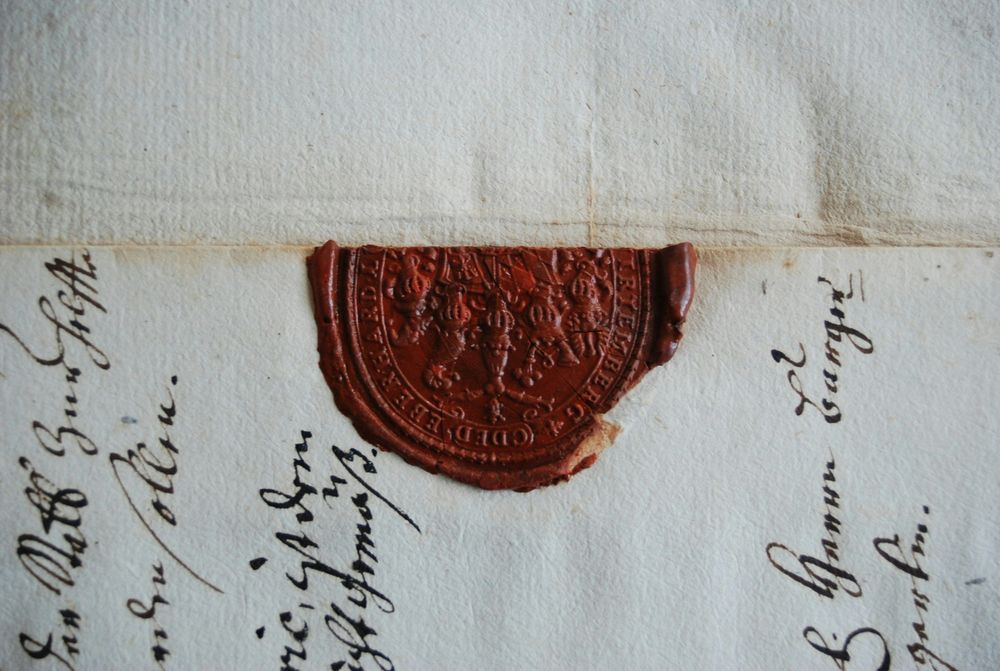Gesetzlich ist erlaubt, dass sich ein Arbeitnehmer verpflichtet, nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses keine konkurrenzierende Tätigkeit aufzunehmen. (Unsplash)

Recht
28.8.2025 | André Brunschweiler
Konkurrenzverbote richtig gestalten: Was das Bundesgericht klargestellt hat
Die Kolumne von André Brunschweiler, Partner der Anwaltskanzlei Lalive in Zürich, gibt Antworten auf juristische Fragen, die Schweizer KMU beschäftigen können beziehungsweise beschäftigen sollten.
Konkurrenzverbote sind ein beliebtes Instrument, um das eigene Know-how zu schützen. Rechtlich sind sie heikel – und können für Arbeitgeber teuer werden, wenn sie nicht sauber formuliert sind. So hatte ein leitender Angestellter ein zweijähriges Konkurrenzverbot unterzeichnet und erhielt im Gegenzug eine Entschädigung. Nachdem er gekündigt hatte, wollte die Arbeitgeberin das Verbot jedoch einseitig aufheben und keine Entschädigung zahlen. Sie berief sich auf ein angebliches Kündigungsrecht. Das Bundesgericht stellte in seinem Urteil klar: Ohne ausdrückliche vertragliche Regelung gibt es kein solches Recht (4A_5/2025 vom 26. Juni 2025).Wenn ein Arbeitgeber dem Arbeitnehmer eine Entschädigung verspricht, damit er das Konkurrenzverbot einhält, stellt dies einen zweiseitigen, verbindlichen Vertrag dar. Ein Verzicht bzw. eine Kündigung durch den Arbeitgeber ist nur möglich, wenn dies ausdrücklich vereinbart wurde.
Nur die Unterschrift zählt
Gesetzlich ist erlaubt, dass sich ein Arbeitnehmer verpflichtet, nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses keine konkurrenzierende Tätigkeit aufzunehmen. Das umfasst etwa die Gründung eines Konkurrenzunternehmens, die Anstellung bei einem direkten Konkurrenten oder eine Beteiligung mit Einfluss auf die Geschäftsführung. Ein Konkurrenzverbot ist unter drei Voraussetzungen gültig: Erstens braucht es eine schriftliche Vereinbarung. Dies bedeutet: eine eigenhändige oder eine qualifizierte elektronische Unterschrift. Einfache elektronische Signaturen – etwa per iPad – oder Unterschriftskopien genügen nicht. Wird im unterzeichneten Arbeitsvertrag ausdrücklich auf ein Reglement oder allgemeine Anstellungsbedingungen verwiesen, die eine Konkurrenzklausel enthalten, genügt dies in der Regel. Zweitens muss der Arbeitnehmer Einblick in den Kundenkreis oder in Geschäftsgeheimnisse haben, deren Verwendung den Arbeitgeber erheblich schädigen könnte. Erforderlich sind somit zwei Elemente: Zugang zu Kunden- oder Geheimniswissen und eine erhebliche Schädigungsgefahr. Wissen, das branchenüblich öffentlich verfügbar ist, gilt nicht als Geschäftsgeheimnis. Fehlen Kundenbeziehungen oder besondere Betriebsgeheimnisse, läuft ein Konkurrenzverbot leer, zum Beispiel bei Profifussballern.
Es kommt auf den Einzelfall an
Drittens stellt ein Konkurrenzverbot eine Einschränkung der Wirtschaftsfreiheit dar und muss daher zeitlich, örtlich und sachlich angemessen begrenzt sein. Es darf den Arbeitnehmer nicht unzumutbar in seiner beruflichen Zukunft behindern. Eine Dauer von mehr als drei Jahren ist nur in Ausnahmefällen zulässig. Fällt das schutzwürdige Interesse des Arbeitgebers weg, erlischt auch das Konkurrenzverbot. Es entfällt ebenfalls, wenn der Arbeitgeber ohne begründeten Anlass kündigt oder der Arbeitnehmer aus wichtigem, vom Arbeitgeber verschuldetem Grund kündigt. Ob ein begründeter Anlass vorliegt, wird im Einzelfall beurteilt. In Arbeitsverträgen wird teilweise eine sogenannte Karenzentschädigung vereinbart – ein Entgelt für die Einhaltung des Konkurrenzverbots, das finanzielle Einbussen kompensieren soll. Doch Vorsicht: Wie das Bundesgericht im eingangs erwähnten Entscheid klargestellt hat, wird ein Konkurrenzverbot durch eine solche Entschädigung zum zweiseitigen Vertrag. Ohne ausdrückliche Klausel kann der Arbeitgeber das Verbot nicht einseitig aufheben oder darauf verzichten, um die Zahlung zu umgehen. Auch eine Anrechnung von Ersatzeinkommen ist nur zulässig, wenn dies vertraglich vorgesehen ist. Fehlt eine solche Regelung, schuldet der Arbeitgeber die volle Entschädigung – selbst wenn der Arbeitnehmer unmittelbar eine neue Stelle antritt. Arbeitgeber sind daher gut beraten, sich vertraglich eine Möglichkeit zum Verzicht oder zur Kündigung des Konkurrenzverbots vorzubehalten, um sich Flexibilität zu wahren und ungewollte Zahlungsverpflichtungen zu vermeiden. Verstösst ein Arbeitnehmer gegen ein wirksames Konkurrenzverbot, schuldet er Schadenersatz. Da der Nachweis eines konkreten Schadens oft schwierig ist, wird üblicherweise eine Konventionalstrafe vereinbart. Sofern schriftlich vereinbart, kann der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer auch gerichtlich untersagen lassen, eine konkurrierende Tätigkeit auszuüben.
Was jetzt zu tun ist
Konkurrenzverbote sind ein scharfes Schwert – aber nur, wenn sie sauber geschmiedet sind. Wer hier nachlässig ist, riskiert nicht nur die Unwirksamkeit des Verbots, sondern auch erhebliche Kosten. Prüfen Sie Ihre Verträge: Liegt Schriftlichkeit vor? Sind Dauer, geografischer Geltungsbereich, Karenzentschädigung und Kündigungsmöglichkeiten klar geregelt? Wenn nicht, ist jetzt der richtige Zeitpunkt, nachzubessern.