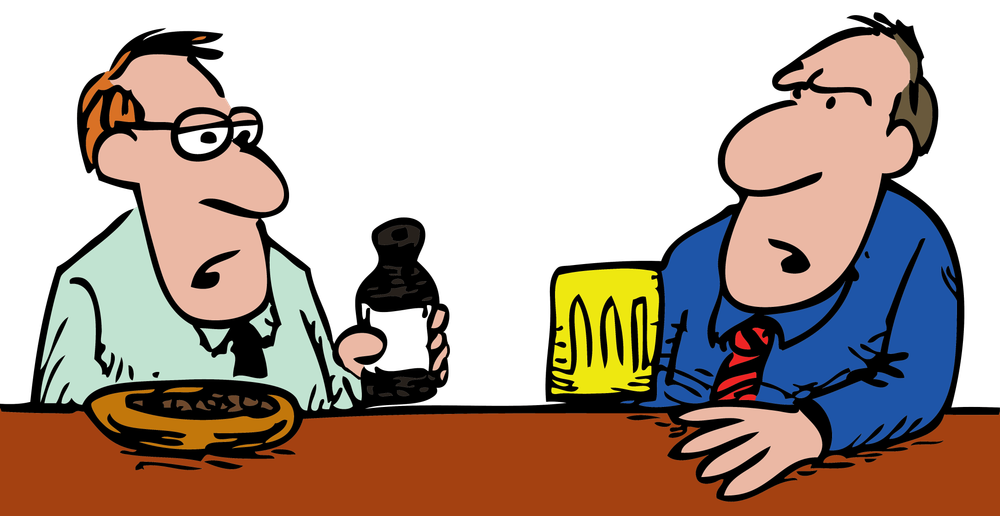Agilität erfordert auch Planungssicherheit. (Laura Adai auf Unsplash)

Führung
29.8.2025 | Fredy Gilgen
Agil, agiler, am agilsten – Unternehmenskultur auf dem Prüfstand
Agiles Arbeiten soll Unternehmen beweglicher machen und Teams motivieren. Viele preisen es als Kulturwandel, andere sehen darin nur einen neuen Namen für Bekanntes. Ein Blick auf Chancen, Grenzen und Schweizer Erfahrungen.
Moden kommen und gehen. Bei der Bekleidung schon lange mehrmals im Jahr. Auch in der Betriebswirtschaftslehre wechseln Leitprinzipien, Arbeitsmethoden und -formen immer häufiger: Desk-Sharing, Job-Sharing, Homeoffice, Hands-on- oder Wasserfall-Methode. Heute steht das agile Arbeiten im Rampenlicht. «Bereits zu einem Hype geworden ist diese Art des Arbeitens in der Informatik», sagt Martin Kropp, Professor für Software Engineering an der FHNW Windisch. Ein Hype, der nun auch andere Branchen erreicht hat. Verständlich: Agiles Arbeiten verspricht Vorteile auf allen Ebenen, bessere Produkte, mehr Tempo, mehr Teamgeist sowie grössere Arbeits- und Kundenzufriedenheit. In Kurzform beschreibt es eine flexible, schrittweise Arbeitsweise, die es Teams erlaubt, schnell auf Veränderungen zu reagieren, kontinuierlich zu lernen und Produkte oder Dienstleistungen laufend zu verbessern.
Wer hat es erfunden?
Erfunden wurde das agile Arbeiten in der Informatik. «Dort besteht die Herausforderung, dass Software-Anforderungen für Kunden und Benutzer oft sehr schwierig zu formulieren sind.» Die Erfahrung zeigte, dass detaillierte Pläne oft unvollständig waren und zu falschen Produkten führten. Erfolgreicher waren jene Projekte, in denen einzelne Anforderungen früh umgesetzt und den Kunden gezeigt wurden. So liess sich das Produkt Schritt für Schritt den Bedürfnissen anpassen. Um das möglich zu machen, setzt man auf eine iterativ-inkrementelle Entwicklung: kurze Zyklen von etwa zwei Wochen, in denen die wichtigsten Anforderungen umgesetzt werden; in jeder Iteration kommen neue hinzu. Das Produkt wächst so kontinuierlich zu einem vollständigen System.
Konsequenzen für Organisation und Führung
Dieses Vorgehen hat drei grosse Konsequenzen: - Entscheidungskompetenzen werden ins Team verlagert. - Der Führungsstil wandelt sich von hierarchisch zu Shared Leadership. - Es zählen nicht Output-orientierte, sondern Outcome-orientierte Ziele.
Nach Definition des US-amerikanischen Softwareentwicklers Jeff Sutherland, einem Mitbegründer des agilen Manifests, handelt es sich bei Agilität nicht um eine Methode oder um Tools, sondern um eine Kultur der Offenheit, Anpassungsfähigkeit und Zusammenarbeit. Dem stimmt Kropp zu: «Agiles Arbeiten ist kein anderer Prozess, sondern eine andere Kultur der Organisation.»
Auch die öffentliche Verwaltung macht mit
In der öffentlichen Verwaltung steht Agilität für einen grundlegenden Wandel. «Weg vom traditionellen Wasserfall-Modell, hin zu einer iterativen, adaptiven Vorgehensweise», sagt Ali A. Guenduez, Assistenzprofessor für Digital Government an der Uni St. Gallen. Für die Mitarbeitenden werden die Ziele klarer, das motiviert. In kleinen Schritten lässt sich die Zielerreichung prüfen und das Vorgehen anpassen. Behörden zeigen sich damit als lernfähige Organisationen, die schneller reagieren können und sich vom Image des trägen Tankers lösen. Genau dieses Bild sei attraktiv, und zwar nicht nur für junge Menschen. «Agilität verspricht, dass Behörden rasch handeln können und so ihre Leistungsfähigkeit wie auch ihr Image stärken», betont Guenduez. In der Startup-Welt ist agiles Arbeiten mehr als ein Trend, es ist eine Überlebensstrategie. «Neugründungen sind praktisch von Natur aus agil unterwegs», sagt Kropp. Auch KMU eigneten sich gut, so Kropp, da sie oft noch wenig Hierarchien hätten und die Kommunikation funktioniere. Schwieriger sei es bei älteren Betrieben mit gewachsener Struktur. Für Grossunternehmen ist die agile Organisation zwar geeignet, sie stösst aber auf die Hürden starrer Hierarchien und etablierter Kulturen. Zusammenarbeit mit Startups kann hier ein Katalysator sein. Anikó Ivanics, Leiterin New Work und Learning bei Kickstart Innovation, sieht Agilität vor allem in Branchen mit schnellen Veränderungen wie Technologie, Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen und Medien. «KMU haben oft einen Vorteil. Grosse Unternehmen verfügen zwar über Ressourcen, müssen jedoch kulturelle Hindernisse abbauen.»
Alter Wein in neuen Schläuchen
Der Berner Betriebswirtschaftsprofessor Claus Jacobs dämpft die Euphorie: «Agilität scheint in der Softwareentwicklung und im IT-Bereich etabliert und weitgehend zu funktionieren. Doch dieser spezifische Herkunftsbezug wird bei der Übertragung auf andere Unternehmensprozesse nicht immer tief genug reflektiert.» Er erinnert dabei an die Experimente bei Volvo in den 1970er-Jahren. In den Werken Kalmar und Uddevalla löste man sich damals vom klassischen Fliessband: Teams montierten nahezu eigenständig komplette Fahrzeuge, entschieden über Tempo und Aufgabenverteilung und erhielten mehr Verantwortung für Qualität und Ergebnis. Was wie ein Vorläufer agiler Prinzipien wirkte, zeigte aber auch Grenzen. Selbst in solchen Modellen bildeten sich rasch neue informelle Hierarchien. Genau darauf spielt Jacobs an, wenn er festhält, dass es «keine sozialen Kontexte ohne Hierarchie» gebe. Und ob alle Business-Vorgänge so planbar seien wie Software, bezweifelt Jacobs. Die grossen Organisationen stellten daher nur teilweise auf Agilität um, was wiederum die Schnittstellenproblematik mit sich bringe, zwischen etablierter Linienorganisation und angestrebter hierarchiefreier Agilität. Am Ende erinnert vieles daran, dass sich auch Agilität in die Reihe vergangener Managementmoden einordnen lässt. Doch ihre Befürworter betonen, dass es um weit mehr geht. «Agiles Arbeiten ist kein anderer Prozess, sondern eine andere Kultur der Organisation», sagt Jeff Sutherland. Und vielleicht entscheidet gerade diese Kultur darüber, ob Agilität bleibt oder verschwindet.

Dieser Beitrag ist erstmals im Rahmen der NZZ-Verlagsbeilage «KMU+» erschienen. Produziert und herausgegeben von NZZ Content Creation. Nicht gekennzeichnete Inhalte sind publizistisch unabhängig entstanden; bei Sponsored Content handelt es sich um kommerziell erworbene Inhalte. Hier geht es zu den NZZ-Richtlinien für Native Advertising.